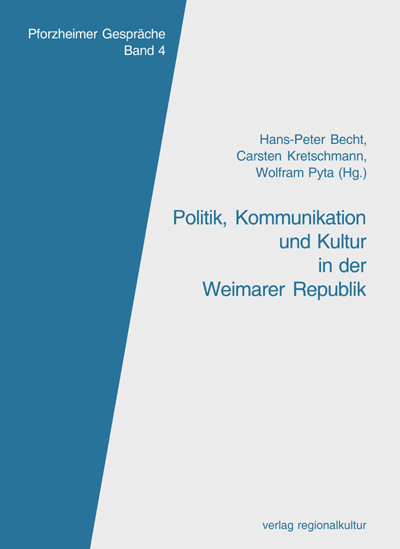Gerade frisch erschienen: die neue Ausgabe von WerkstattGeschichte mit dem Schwerpunkt „anti/koloniale filme“. Darin ist ein Aufsatz von mir enthalten, der sich der Rezeption des italienischen Films „Africa Addio“ (1966) widmet. Dieses „shockumentary“ setzt sich – aus kolonialer Perspektive – mit dem Prozess der Dekolonisation auseinander und löste im Sommer 1966 einen der größeren, gleichwohl von der Forschung bislang nur wenig beachteten Filmskandale der Bundesrepublik aus. Dieser wurde schließlich von der sich formierenden Studentenbewegung radikalisiert. Der Beitrag zeigt, wie der Fall durch die schockauslösende Qualität filmischer Authentizität und deren skandalösem Potential prominent und vernehmbar eine Stellvertreterdebatte über das Verhältnis Deutschlands und Europas zum postkolonialen Afrika anstieß. Der Skandal als Modus der Auseinandersetzung führte jedoch dazu, dass diese Frage rasch aus dem Fokus verschwand. Als Studenten der Freien Universität Berlin – in Verbindung mit afrikanischen Kommilitonen – in einem Berliner Kino randalierten und auf dem Kurfürstendamm lautstark gegen „Africa Addio“ demonstrierten, wurde der ursprüngliche Auslöser im Rahmen eines Skandals zweiter Ordnung bald vollständig überlagert von Empörung über die Aktionsformen der Protestierer und der Frage ihrer Legitimität. Die Studenten wiederum transponierten den Fall „Africa Addio“ in einen Skandal um den bundesdeutschen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Der Versuch, einen Zusammenhang von deutscher faschistischer Tradition und dem Schicksal des afrikanischen Kontinents zu entlarven, endete letztlich in einer allein auf Deutschland fixierten Auseinandersetzung. Den Protagonisten des Skandals lagen ihre eigene Gesellschaft, ihre politische Kultur und die Behauptung bzw. Erlangung von Deutungshoheit letztlich näher als die Sache des fernen Afrika.
Gerade frisch erschienen: die neue Ausgabe von WerkstattGeschichte mit dem Schwerpunkt „anti/koloniale filme“. Darin ist ein Aufsatz von mir enthalten, der sich der Rezeption des italienischen Films „Africa Addio“ (1966) widmet. Dieses „shockumentary“ setzt sich – aus kolonialer Perspektive – mit dem Prozess der Dekolonisation auseinander und löste im Sommer 1966 einen der größeren, gleichwohl von der Forschung bislang nur wenig beachteten Filmskandale der Bundesrepublik aus. Dieser wurde schließlich von der sich formierenden Studentenbewegung radikalisiert. Der Beitrag zeigt, wie der Fall durch die schockauslösende Qualität filmischer Authentizität und deren skandalösem Potential prominent und vernehmbar eine Stellvertreterdebatte über das Verhältnis Deutschlands und Europas zum postkolonialen Afrika anstieß. Der Skandal als Modus der Auseinandersetzung führte jedoch dazu, dass diese Frage rasch aus dem Fokus verschwand. Als Studenten der Freien Universität Berlin – in Verbindung mit afrikanischen Kommilitonen – in einem Berliner Kino randalierten und auf dem Kurfürstendamm lautstark gegen „Africa Addio“ demonstrierten, wurde der ursprüngliche Auslöser im Rahmen eines Skandals zweiter Ordnung bald vollständig überlagert von Empörung über die Aktionsformen der Protestierer und der Frage ihrer Legitimität. Die Studenten wiederum transponierten den Fall „Africa Addio“ in einen Skandal um den bundesdeutschen Umgang mit der NS-Vergangenheit. Der Versuch, einen Zusammenhang von deutscher faschistischer Tradition und dem Schicksal des afrikanischen Kontinents zu entlarven, endete letztlich in einer allein auf Deutschland fixierten Auseinandersetzung. Den Protagonisten des Skandals lagen ihre eigene Gesellschaft, ihre politische Kultur und die Behauptung bzw. Erlangung von Deutungshoheit letztlich näher als die Sache des fernen Afrika.
Die Ausgabe von WerkstattGeschichte enthält eine Auswahl von Vorträgen, die auf einer im Dezember 2013 in Gießen veranstalteten Tagung zum (anti-)kolonialen Film gehalten wurden. Das Heft ist über den Buchhandel zu beziehen oder direkt beim Klartext Verlag.
Der Schock der Authentizität. Der Filmskandal um Africa Addio (1966) und antikolonialer Protest in der Bundesrepublik, in: WerkstattGeschichte 69 (2015), S. 35-51.

 Noch ein Nachtrag: Im
Noch ein Nachtrag: Im